MIKROKONTAKT
Tag Archives for soso
Wie gut, dass ich zeichnen kann, denke ich.
Schnurstracks aufs Entscheidende zielen. Das ist immer dann hilfreich, wenn ich innerlich Wahrgenommenes sichtbar festhalten will oder das Täfelchen nicht bei mir habe.

„Was, was?“, rufe ich seinem unverständlichen Gemurmel zu. Er, sagt er daraufhin vernehmbarer, gehöre ja nicht zu jenen, die sich die Pfauenfedern in den Krähenpelz stecken. Und setzt, vielleicht meines ratlosen Blickes wegen, mit winkender Handbewegung hinzu, der Pfau sei der Vogel der Juno.
Unter einer Juno kann ich mir was vorstellen und die Redewendung sich mit fremden Federn schmücken sagt mir was, die Fabel, auf die sich der Ikonograph auf seinem Sterbebett bezieht, kenne ich zu diesem Zeitpunkt nicht.
Fabeln sind Geschichten ohne Zwischentöne: die eine Seite ist drauf, die andere dran, entlarvt, getäuscht oder sonstwie vorgeführt. Oft sind sie Einschüchterungsgeschichten, lachende Warnung.
Die Krähe schau’ ich mir genauer an.
50 Pfauenfedern abzugeben rufe ich in den virtuellen Raum. Eine Frau mit seidigem, blonden Haar kommt und nimmt sie mit.
Schönes Tier!
Wo die Pyramiden stehen von David Macaulay ist das erste Buch, das ich erinnere in einem Zug durchgelesen zu haben. Und ich erinnere, das damals durchaus als Leistung empfunden zu haben.
Das Heilkleid
Mein Heilkleid hat zwei Beine und auf der linken Schulter fünf Knöpfe. Es ist dehnbar und von einem Rot, das der Hersteller ruby nennt. Ein Gürtel gehört auch dazu.
Als es im Februar mit einem Mal so beinah frühsommerlich warm ist, sehe ich es im Vorübergehen in einem Schaufenster – und erkenne es in diesem Moment.
Seit ich es besitze, weiss ich, dass es ein Heilkleid ist.
Ein Heilkleid ist ein Kleid, in dem ich heil bin.
Im Heilkleid bin ich heil.
ganz
unversehrt
Das ist seine Gabe.
Zur Medizingabe passt, dass es einen gewissen Widerstand gibt. Vielleicht gerade, weil es so dehnbar ist.
be big, sagt es.
Aus dem Südasien-Institut der Universität Heidelberg kommt der 5 Pfund schwere Bildband, in den die Bibliothekarin vor meinen Augen den Fernleihzettel dort ins Buch legt, wo das Hochzeitsfoto des Malers abgebildet ist. Weil ich es kaum erwarten kann, das Buch anzuschauen, setze ich mich vor der Bibliothek auf eine Bank in der Abendsonne und blättere es durch. Mir steigen Tränen in die Augen und ich frage mich, ob das jetzt nicht etwas übertrieben ist. I wo. Wie der Säugling die an ihn gerichtete Rede gewahrt, ohne deren Sinn zu verstehen, schaue ich auf diese Bilder, die ich nicht verstehe und spüre doch, wie sie zu mir sprechen.
Gemälde, das sind die Bilder mit Gewicht.
Während ich am Küchentisch sitze und warte, dass sich die Seite aktualisiert, bemerke ich die Birne, die ich vorhin in meiner Jackentasche heimgetragen habe, damit die empfindliche Frucht keinen Schaden nimmt auf dem kurzen Weg vom Geschäft in meine Küche. Ohne groß darüber nachzudenken hatte ich sie auf der metallenen Arbeitsfläche abgelegt und so ein zufälliges Stillleben erzeugt, an dem sich nun mein Blick verfängt. Das muss ich malen, denke ich.
Es sieht schön aus und macht doch stutzig.
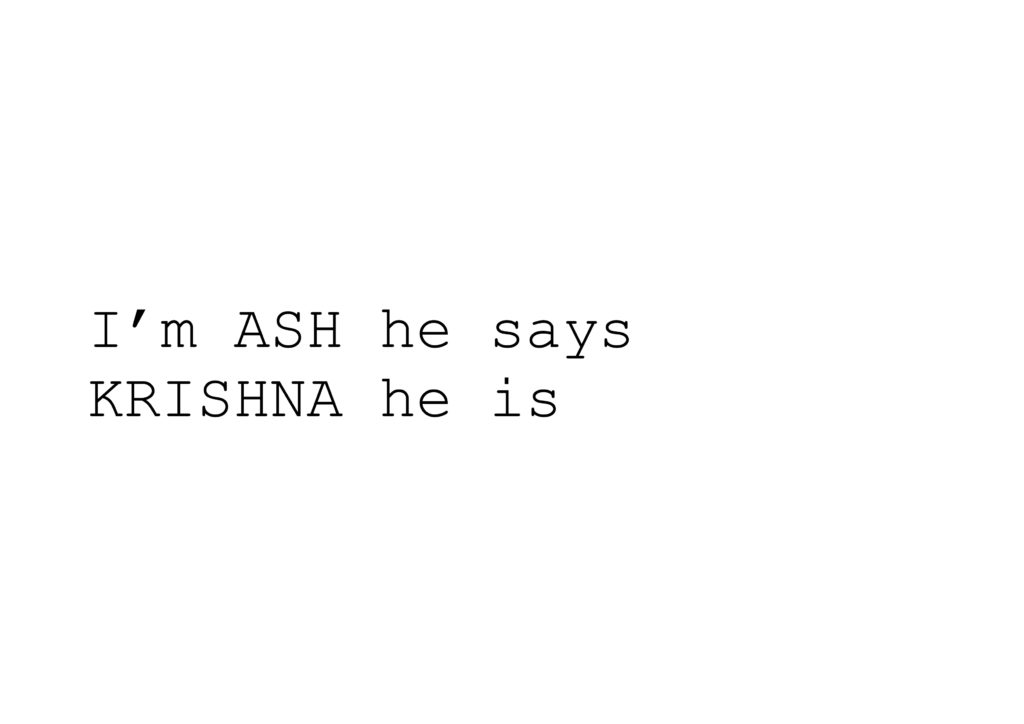
Laut spreche ich den Text in die Diktierfunktion. Seitenweise lese ich so diese Handschrift, die mir vertrauter ist als der Mensch, der sie hinterließ: das wird mir klar, während ich diese Mühe auf mich nehme, die manch anderer vielleicht unsinnig erschiene.
Verrückt, eine absolut verrückte Geschichte, die mir, wäre sie frei erfunden, unerträglich wäre.
Nur selten kann ich eine Buchstabenfolge nicht entziffern. Dann hilft mir die Grosse Linse und verursacht dabei jedesmal einen winzigen Schwindel.
nanakorobi yaoki
Was ist schöner als der volle Mond? – Die Wolke, die sich davor schiebt.
— Japanisch
Aufgrund der geringen Verbrauchsmenge können wir Sie leider nicht versorgen.
Symmetrie ist für das Oval nicht zwingend.
Mit dem flachen, breiten Pinsel wird der meiste Unfug getrieben.
Tollkühnheit kann eine uninspirierte Situation mit Offenheit versorgen – mehr eher nicht.